Sie können Ihre Mitarbeitenden mit Flucht- und / oder Migrationserfahrung beim Thema Sprachförderung auch im Betrieb bei der Arbeit aktiv unterstützen. Hier finden Sie kompakte Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Sprachförderung. Es soll Ihnen helfen, auf Situationen oder auch Fragen der Mitarbeitenden mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrung angemessen reagieren zu können.
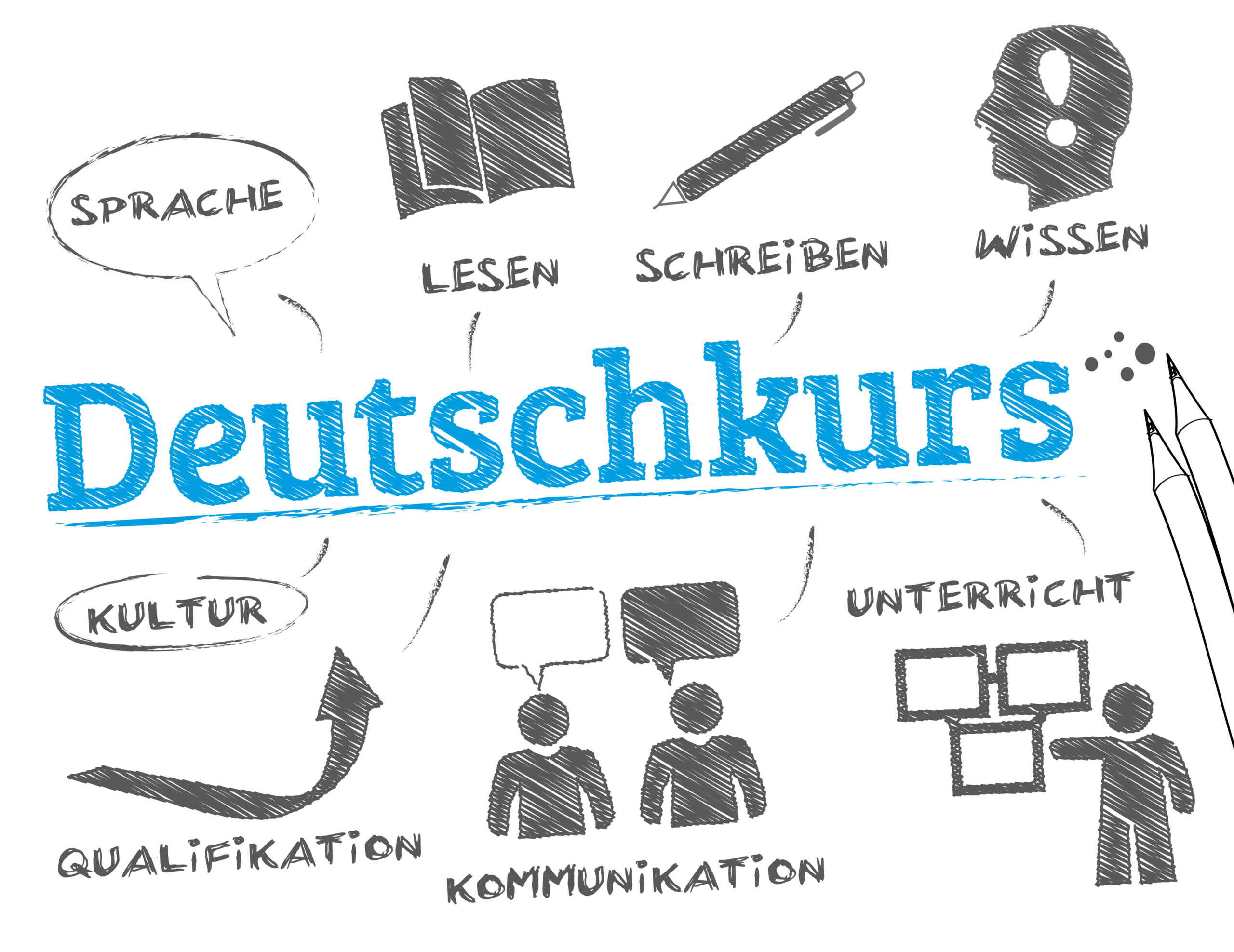
Spracherwerb und Kommunikation
Die Berufssprachkurse des BAMF
Was heißt das überhaupt?
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bietet eine Vielzahl von Berufssprachkursen an, die speziell darauf ausgerichtet sind, Menschen mit Migrationshintergrund auf die Arbeitswelt in Deutschland vorzubereiten.
Wie sieht das praktisch aus?
Diese Kurse sind flexibel gestaltet und können sowohl in Präsenz als auch virtuell oder hybrid durchgeführt werden. Sie bieten eine wertvolle Unterstützung für Betriebe, die Beschäftigte mit Flucht- und Migrationserfahrung bei dem Erwerb der deutschen Sprache unterstützen möchten.
Hier sind einige der Hauptkategorien der Sprachkurse:
- Berufsfeldübergreifende Kurse: Diese Kurse sind darauf ausgelegt, berufsübergreifende Deutschkenntnisse im arbeitsweltlichen Kontext zu vermitteln. Es gibt verschiedene Niveaus, die sich nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) richten: B1 auf B2, B2 auf C1 und C1 auf C2.
- Berufssprachkurse zur Anerkennung beruflicher Abschlüsse: Diese Kurse sind für Personen, die sich im Anerkennungsverfahren zu akademischen Heilberufen und Gesundheitsfachberufen befinden.
- Job-BSK: Diese Kurse sind speziell darauf ausgelegt, berufsbezogene Sprachkenntnisse zu vermitteln, die direkt am Arbeitsplatz benötigt werden. Sie beinhalten berufsbezogenes Kommunikationstraining, arbeitsplatz- und fachspezifische Vertiefung sowie individuelles Sprachcoaching.
- Fachspezifische Berufssprachkurse: Diese Kurse sind auf bestimmte Berufsfelder wie Gewerbe/Technik und Einzelhandel ausgerichtet und vermitteln praxisnahe fachspezifische Sprache.
- Azubi-BSK: Diese Kurse sind speziell für Auszubildende konzipiert und bieten eine Kombination aus fachlicher und sprachlicher Ausbildung.
Bea Praxistipps:
Individuelle Beratung
Sie haben Fragen? Gern beraten wir Sie: Kontakt
Weiterführende Links:
Überblick über die Berufssprachkurse (BSK) des BMAF:
www.bamf.de
Berufssprachkurse in Ihrer Nähe finden:
Berufssprachkurse | Sprachförderung | Bundesagentur für Arbeit
Einfache Sprache
Was heißt das überhaupt?
Durch den Gebrauch Einfacher oder Verständlicher Sprache nutzen Sie eine Sprache, die es allen Mitarbeitenden gleichermaßen ermöglicht, das Gelesene / Gehörte zu verstehen. Dieses kann auf schriftlicher als auch auf gesprochener Ebene erfolgen. Hierbei geht es darum, dass Sie Ihr Personal (unabhängig von Herkunft und Qualifikation) dazu befähigen, seine Arbeit, die Arbeitsanweisung und Zusammenhänge seiner Arbeit besser verstehen zu können.
Wie sieht das praktisch aus?
Vereinfachen Sie schwierige Texte. Überlegen Sie dafür zuerst, wer Ihre Zielgruppe ist, die von der Einfachen Sprache profitieren soll. Filtern Sie die Hauptaussage heraus. Welche Wörter müssen durch einfachere Wörter ersetzt werden? Welche können behalten werden? Schreiben Sie dann pro Zeile einen kurzen Hauptsatz. Der Inhalt bleibt erhalten, wird aber leichter verständlich und unterstützt damit auch direkt die Arbeit.
Beispiel:
Bei dieser Patientengruppe erfolgt der Besuch unter vorheriger Anmeldung.
Besser so:
Sie möchten einen Patienten besuchen? Bitte melden Sie sich vorher an.
Bea Praxistipps:
Passen Sie Ihren Text an Ihre Zielgruppe an. Verwenden Sie:
Individuelle Beratung
Sie haben Fragen? Gern beraten wir Sie: Kontakt
Weiterführende Links:
IQ-Fachstelle berufsbezogenes Deutsch:
Dokumente vereinfachen
IQ-Fachstelle berufsbezogenes Deutsch:
Checkliste: Spreche ich verständlich?
Infoportal Einfache Sprache:
Infoportal Einfache Sprache
Sprachmentoring
Was heißt das überhaupt?
Sprach-Mentoring unterscheidet sich vom allgemeinen Mentoring dadurch, dass es speziell auf den Erwerb von Alltags- und Fachsprache zielt. Es eignet sich für Mitarbeitende oder auch Auszubildende, die Sie am Arbeitsplatz beim Deutschlernen fördern / unterstützen möchten, da sie noch nicht so viel Deutsch verstehen, wie sie für den Beruf brauchen. Mitarbeitende und Auszubildende, die Sie hierbei gerne unterstützen würden, sollten sprachlich und fachlich fit sein, um als Sprach-Mentorinnen oder Sprach-Mentoren zu fungieren.
Wie sieht das praktisch aus?
Mitarbeitende können sich im Team idealerweise untereinander besser unterstützen als Vorgesetzte. Als Erstes und am einfachsten können Sie Mitarbeitende motivieren und als Mentorin oder Mentor gewinnen, die sozial engagiert sind, möglichst eine oder mehrere Sprachen außer Deutsch sprechen und sich gegebenenfalls gerne weiterbilden würden. Sprach-Mentoring eignet sich als innerbetriebliche Ergänzung zu Sprachkursen, um die Anwendung der Sprache und des Erlernten am Arbeitsplatz zu üben. Ziele für das Mentoring sollten nach der SMART-Formel bestimmt werden:
- Spezifisch
- Messbar
- Attraktiv
- Realistisch
- Terminiert
Bea Praxistipps:
Individuelle Beratung
Sie haben Fragen? Gern beraten wir Sie: Kontakt
Damit gelingt es Ihnen, den Betrieb mit den hier aufgezeigten Möglichkeiten zu einem „Lernort für Sprache“ für und mit Ihrer Belegschaft gemeinsam zu gestalten und damit langfristig eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller Betriebsangehörigen zu gewährleisten.
Weiterführende Links:
Fachstelle berufsbezogenes Deutsch:
Material für die Arbeit im Tandem
Handreichung mit vielen praxisnahen Tipps zur Sprachförderung am Arbeitsplatz:
Handreichung Sprachförderung im Betrieb
Eine Liste mit vielen hilfreichen Online-Angebote zum Spracherwerb:
Linkliste Sprachförderung
Bea-Brandenburg – Wir schulen Ihre Mentor*innen:
Sprachmentoring im Betrieb
Sprach- und Kulturmittlung
Was heißt das überhaupt?
Unter Sprach- und Kulturmittlung ist eine mündliche Form der Übersetzung zu verstehen, bei der Gesprächskontexte für alle Beteiligten gleichermaßen und wechselseitig übersetzt werden. Der Vorteil ist, dass dabei das interkulturelle Verständnis und mögliche Erwartungen und Verhaltensweisen besser berücksichtigt und transparent gemacht werden. Dadurch können mögliche Missverständnisse verhindert oder auch beseitigt, Fragen geklärt, Feindseligkeiten aufgelöst und zu einem gemeinschaftlichen Betriebsklima beigetragen werden.
Wie sieht das praktisch aus?
Mit Sprach- und Kulturmittlungen können Sie in Ihrem Betrieb dazu beitragen, dass:
- mehr Klarheit bzgl. beidseitiger Erwartungen und Gewohnheiten befördert wird,
- ein besseres gegenseitiges Verständnis der Arbeitsschritte gewährleistet wird,
- Ihre Mitarbeitenden sich besser verstehen und produktiver zusammenarbeiten,
- Fragen geklärt und beantwortet werden,
- Mitarbeitende sich stärker an das Unternehmen gebunden fühlen.
Bea Praxistipps:
Eine gute Vorbereitung der Sprachmittlung hilft, genaue Übersetzungen zu liefern, Missverständnisse zu vermeiden und die Zeit einzuhalten. Klären Sie vorab mit allen Beteiligten:
Angebot Sprachmittlung;
Bea-Brandenburg bietet für Brandenburger Betriebe die Vermittlung und Begleitung einer kostenlosen SAVD-Sprachmittlung an: Kontakt
Weiterführende Links:
Sprachmittlung: Eine Praxishilfe für Fachkräfte – ISA – Gesellschaft für Inklusion und Soziale Arbeit:
Erfolgreiche Sprachmittlung – Eine Praxishilfe für Fachkräfte
Arbeitshilfe: Wie gelingt Sprachmittlung in der Beratung? – Caritas:
Einen Sprachkurs im Betrieb organisieren
Was heißt das überhaupt?
Ein Sprachkurs bei Ihnen vor Ort und angepasst an die speziellen Gegebenheiten Ihres Betriebs bietet die Möglichkeit, gezielt auf die Lernbedarfe Ihrer Belegschaft einzugehen. Durch den Erwerb berufs- und betriebsspezifischer Sprachkenntnisse können Mitarbeitende ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern, Missverständnisse vermeiden und sich langfristig im Unternehmen entwickeln.
Wie sieht das praktisch aus?
Damit sie miteinander lernen können, sollten die Teilnehmer*innen einer Gruppe ein ähnliches Sprachniveau haben. Dies lässt sich über einen kostenlosen Online-Sprachtest ermitteln. Darüber hinaus sollte der Anbieter des Sprachkurses einen eigenen Einstufungstest durchführen. Achten Sie auch auf Alphabetisierungsbedarfe Ihrer Mitarbeitenden. Es gibt bei der Kursplanung einiges zu beachten, damit Ihr betriebsinterner Kurs den gewünschten Erfolg erzielt. Bea-Brandenburg berät Sie gerne, sucht passende Bildungsanbieter heraus und informiert Sie zu den Fördermöglichkeiten.
Bea Praxistipps
Bitte beachten Sie bei der Planung des Kurses folgende Rahmenbedingungen:
Individuelle Beratung
Sie haben Fragen? Gern beraten wir Sie: Kontakt
Weiterführende Links:
bea-Brandenburg Checkliste interne Sprachkurse:
bea_Checkliste-betriebsinterne-Sprachkurse.pdf
Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch – Materialsammlung:
arbeitsplatzbezogene Materialien | Deutsch am Arbeitsplatz
Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch – Deutschkurse im Unternehmen:
Deutschkurse in Unternehmen | Deutsch am Arbeitsplatz
Make it in Germany – Deutschkurse:
Deutschkurse
Download
Handreichung: Sprachförderung im Betrieb
In diesem Leitfaden finden Sie kompakte Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Sprachförderung im Betrieb.
Download: Handreichung Sprachförderung im Betrieb: *pdf
Checkliste: Sprachkurs im Betrieb organisieren
Sie haben mehrere Mitarbeitende, die ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten?
Für die Organisation eines Deutschkurses bzw. einer Qualifizierung mit Sprachkomponente hilft diese Checkliste dabei, folgende Aspekte im Blick zu behalten:
- Qualifizierungsbedarfe ermitteln
- Kursziele definieren
- Sprachniveau einschätzen
- Bildungsträger auswählen
- Räume und Rahmenbedingungen auswählen
- Ansprechpartner*innen für eine Förderung finden.
Download: „Checkliste Sprachkurs im Betrieb organisieren“: *.pdf
Linkliste: Online-Angebote zur Sprachförderung
Hier finden Sie eine Auswahl an Online-Angeboten, die Sie beim Erwerb der deutschen Sprache unterstützen und Ihnen den Lernprozess erleichtern können.
Download Linkliste Sprachförderung: *.pdf
